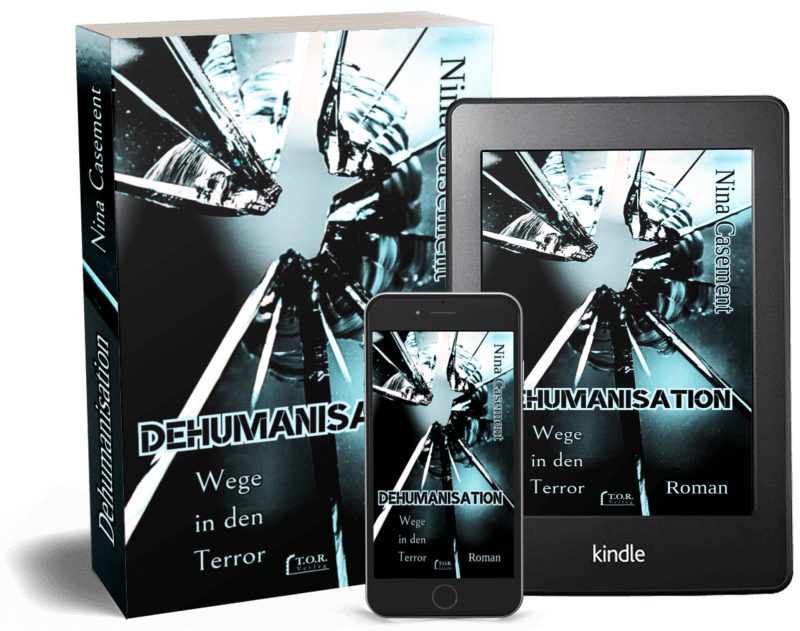Auch wenn „Dehumanisation – Wege in den Terror“ fiktive Schicksale erzählt, bezieht sich das Buch auf ebenso reale wie tragische Hintergründe. Die hier geschilderten Verbrechen und Zustände bestehen ausnahmslos bis jetzt oder wurden niemals vollständig juristisch aufgeklärt, geschweige denn Verantwortliche bestraft.
Islamische Revolution (Iran)
Bis 1979 herrschte im Iran der Schah Mohammad Reza Pahlavi in Form eines monarchischen Systems. Diese Zeit war von relativem Wohlstand dank des Rohstoffreichtums und guter Wirtschaftsbeziehungen unter anderem zu den USA geprägt. Zudem herrschte ein – verhältnismäßig – liberales gesellschaftliches Klima vor. Frauen standen Hochschule und viele Berufe sowie die Wahl ihrer Kleidung von staatlicher Seite aus offen (nicht unbedingt von familiärer). Bildung war säkularisiert und das Miteinander zwischen Muslimen, Christen, Juden, Baha’i und Zoroastriern verlief überwiegend friedlich.
Allerdings litt das Land zugleich unter der Alleinherrschaft, denn eine demokratische oder durch die Bevölkerung getragene Regierungsbildung war nicht vorgesehen. Politische Gegner wurden unterdrückt, nicht selten verschwanden sie in Gefängnissen, wo sie gefoltert und hingerichtet wurden, insbesondere durch den berüchtigten Inlandsgeheimdienst SAVAG. Auch durch Einflussnahme der USA wurden Gesetze erlassen, die die religiösen Gefühle vieler Bürger verletzten. Bewegungen, die Ideen aus dem Kommunismus und Sozialismus umsetzen wollten, wurden oftmals gewalttätig unterdrückt.
Mit der Einführung neuer, liberaler Gesetze erhielt ein Bündnis linker und sowohl gemäßigt als auch extremistisch islamischer Gruppen Zulauf, das sich um den im Exil lebenden Ruhollah Chomeini sammelte. Nach Demonstrationen und Unruhen folgte schließlich der Umsturz. Daraufhin entstand jedoch keine Demokratie, stattdessen wurde die Alleinherrschaft Ayatollah Chomeinis ausgerufen und eine Islamische Republik proklamiert. In der Folge kam es zunächst zur Verfolgung politischer Gegner, später jedoch auch zur Inhaftierung, Folter und Hinrichtung ehemaliger Verbündeter, vor allem linksgerichteter Strömungen sowie Angehörigen der Religionsgemeinschaft der Baha’i.
Diese gipfelten ab dem 29. Juli 1988 in der größten Hinrichtungswelle im Iran, bei der binnen weniger Tage einige tausend, möglicherweise jedoch sogar mehr als 30.000 Gefangene durch qualvolles Erhängen ermordet wurden. Trotz der Größenordnung wurden die Tötungen geheimgehalten – offiziell streitet der Iran das Geschehen bis zum heutigen Tag ab. Das im Voraus gut organisierte Massaker fand im Evin-Gefängnis statt, das zu diesem Zweck vollständig abgeriegelt wurde. Hinrichtungen ohne Prozess waren jedoch auch in den Jahren vor sowie nach diesem Ereignis an der Tagesordnung, wobei auch Frauen und Minderjährige betroffen waren.
Evin-Gefängnis
Neben den Hinrichtungen war und ist das Evin-Gefängnis vor allem aufgrund der dort stattfindenden Folter berüchtigt, die sich laut Überlebenden über die Jahrzehnte hinweg intensiviert hat. Überbelegung, schlechte Gesundheitsversorgung, Willkür und sexuelle Gewalt prägen das Leben der Gefangenen. Dies betrifft auch weibliche Gefangene, die in einem eigenen Trakt untergebracht sind. Internationale Aufmerksamkeit erregte das Teheraner Gefängnis jedoch lediglich, als die iranisch-kanadische Journalistin Zahra Kazemi während einer Reise 2003 ein Foto des Eingangs schoss und daraufhin noch vor Ort verhaftet wurde. Im Gefängnis starb sie binnen eines Tages an Verletzungen durch schwerste Folter und Vergewaltigung – unter anderem wurden später ausgerissene Nägel, gebrochene Knochen, innere Blutungen und eine Schädelfraktur nachgewiesen.
Abu Ghuraib
Abu Ghuraib, später „Zentralgefängnis von Bagdad“, wurde bereits lange vor dem Einmarsch der Amerikaner gebaut und vor allem unter Machthaber Saddam Hussein für Folter und Hinrichtungen benutzt. Die Zustände verschlimmerten sich, als US-Truppen das Gefängnis übernahmen und für ihre Zwecke verwendeten. Ab 2004 gelangten in mehreren Chargen Fotos und medizinische sowie geheimdienstliche Berichte an die Öffentlichkeit, die schwerste Folter, Verstümmelung und Vergewaltigung zeigen und beschreiben. Mindestens hundert Insassen wurden zu Tode gefoltert, wobei Bilder der Verletzungen den Schluss zulassen, dass es sich nicht um „Unfälle“, sondern bewusste Morde handelte. Regelmäßig wurden Gefangene so schwer gefoltert, dass sie den Verstand verloren. Suizidversuche oder Hungerstreiks zogen weitere Folter sowie schwere sexuelle Misshandlung nach sich.
Auch die Haft und Haftumstände selbst entsprachen den Bedingungen in einer Diktatur, da es zu keinem Gerichtsverfahren kam und keine offiziellen, an ein Delikt gebundenen Strafen verhängt wurden. Selbst die ehemalige Gefängnis-Kommandantin Janis Karpinski geht davon aus, dass 90 Prozent der Häftlinge unschuldig waren. In der Folge wurden lediglich neun Soldaten überhaupt verurteilt, wobei ihre Haftstrafen zwischen wenigen Monaten und einigen Jahren angesetzt wurden. Anklagen wegen Mordes, schwerer Folter oder Vergewaltigung wurden nicht erlassen. Höherrangige Verantwortliche wurden – obschon Aufzeichnungen existieren, die die Aufforderung zu Folterpraktiken wie Elektroschocks oder Ausreißen der Nägel beinhalten – bis heute niemals gerichtlich belangt.
Falludscha
Falludscha ist eine irakische Großstadt, die 50 Kilometer westlich von Bagdad entfernt liegt und überwiegend von Sunniten, der Glaubensgruppe, der auch Machthaber Saddam Hussein angehörte, bewohnt wird. Sie zeichnete sich durch viele Moscheen sowie eine gute Infrastruktur aus. Im Irakkrieg fand sie medial große Beachtung, da zwischen Ende 2003 bis Ende 2004 besonders intensive Kämpfe mit US-Truppen stattfanden. Zunächst verlief die Einnahme der Stadt friedlicher als in anderen Regionen, später jedoch gerieten amerikanische Truppen und Bevölkerung aufgrund verschiedener Maßnahmen – Ausgangssperren, Besetzung von Gebäuden – aneinander. 2004 gipfelte der Krieg in Belagerung, Bombardement und schweren Gefechten. Im Rahmen der Kampfhandlungen wurde die Zivilbevölkerung aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Jedoch hinderten amerikanische Truppen zeitweise männliche Bewohner an der Flucht. Aufgrund der Bombardierung wurde ein großer Teil der Stadt zerstört.
Während der Kampfhandlungen wurde Munition mit weißem Phosphor eingesetzt, die aufgrund der extrem qualvollen Verletzungen und des Todeskampfs hochumstritten ist. Bestimmte Einsätze sind auch aufgrund der schwerwiegenden Langzeitschäden für die Zivilbevölkerung verboten, da Phosphor extrem giftig ist. Zwei Jahre nach der letzten großen Angriffswelle wurde ein Anstieg mehrerer schwerer Erkrankungen unter Zivilisten beobachtet. Dazu zählten verschiedene Krebsarten – am auffälligsten war eine um das 38-Fache angestiegene Rate extrem aggressiver Leukämie sowie Hirntumore, Lymphome und Brustkrebs. Hinzu kamen zahlreiche weitere, teilweise sonst seltene Erkrankungen sowie eine Vielzahl Gendefekte. Die Rate missgebildeter und totgeborener Kinder stieg außergewöhnlich. Bei einigen Erkrankungen gleichen die Zahlen denen, die bei Überlebenden der Hiroshima-Bomben gefunden wurden, einige übersteigen diese noch – um das Doppelte bei Leukämie.
Als Ursache in Verdacht geriet unter anderem panzerbrechende Uranmunition. Diese besteht üblicherweise aus abgereichertem Uran mit geringer Strahlung – so wurden in Basra Strahlungs-Hintergrundwerte in 20-facher Höhe des Normalwerts gefunden. In Falludschah hingegen wurde an Panzern teilweise die 180-fache Strahlenbelastung gemessen, ebenso in Trinkwasser- und Erdproben sowie Haaren erkrankter und missgebildeter Kinder. Der Beweis für einen Zusammenhang steht offiziellem Bekunden nach weiterhin aus.
Ausgewählte Quellen:
Focus-Artikel zu den Kriegsfolgen
SWR-Sendung zum Einsatz von Uranmunition